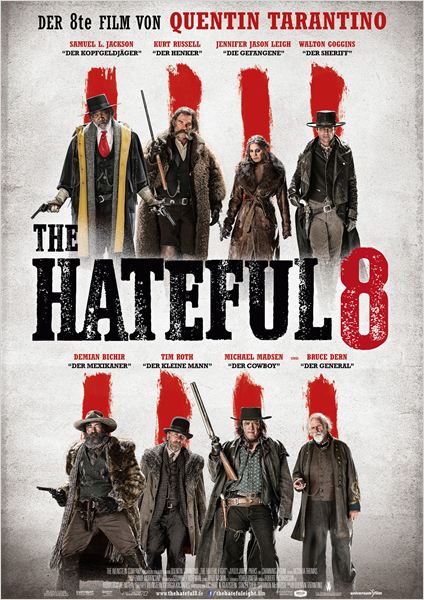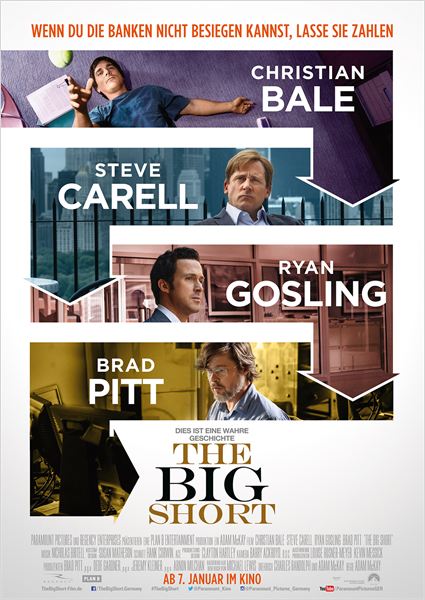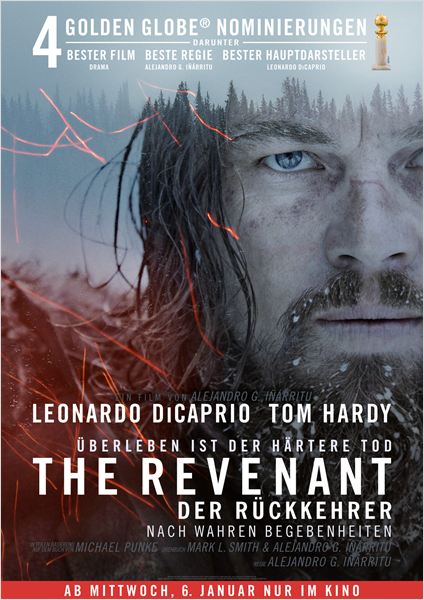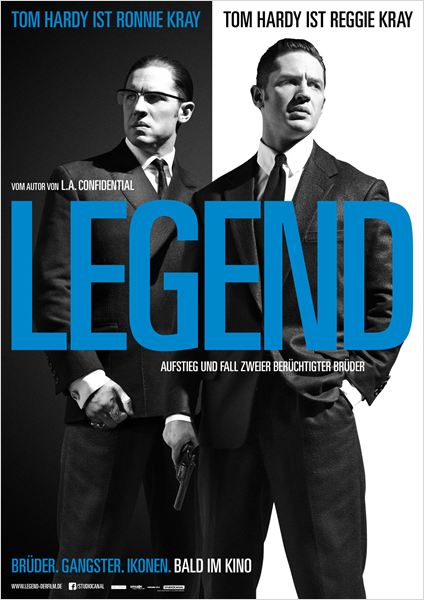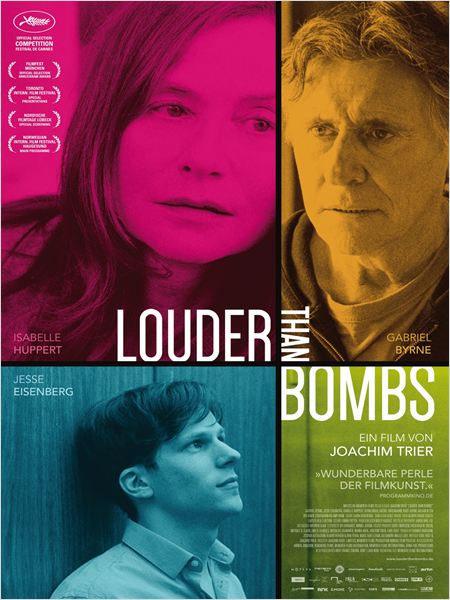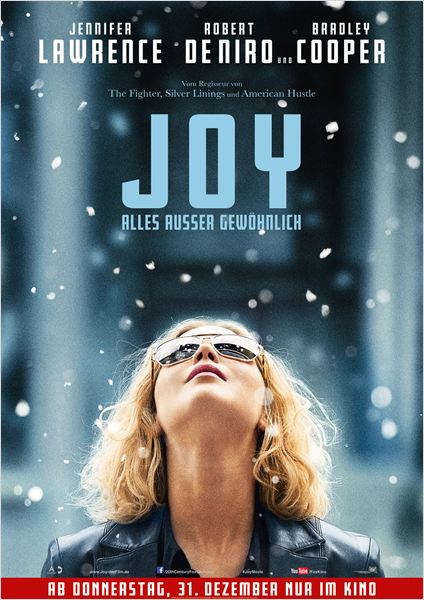Diese liegt auch der nun folgenden Kritik zugrunde.
The Hateful 8
Seit 1966 wurde das Ultra Panavision 70-Verfahren nicht mehr für einen Kinofilm eingesetzt. Die enorm breiten Panoramen aus Ben Hur, Vom Winde verweht oder Lawrence von Arabien verdanken wir dem Seitenverhältnis von 2,76:1, wie es das Drehen auf 70mm (respektive 65mm) Film ermöglicht. Quentin Tarantino erkannte nun Ultra Panavision 70 als die beste Möglichkeit das epische Gefühl dieses Filmaufnahmeverfahrens wiederzubeleben. Damit einher geht die Aufführung von The Hateful 8 in der vom Regisseur bevorzugten Variante – der Roadshow. Diese Art der Präsentation war in der großen Hollywood-Ära der 50er und 60er Jahre weit verbreitet. Filme wurden mit Ouvertüre und Intermission gezeigt und ähnelten viel eher gesellschaftlichen Ereignissen als durchschnittlichen Kinobesuchen, Zuschauer warfen sich in Schale und bekamen Programmhefte gereicht. Diese Eigenschaften prasseln nun zusätzlich zu einem dreistündigen Opus Magnum auf den ungeübten Konsumenten aus dem Youtube-Clip-Zeitalter ein - Eine fordernde, aber lohnende Erfahrung. Folgerichtig nutzt Tarantino die verordnete Pause, um The Hateful 8, der zugleich Western und Kammerspiel ist, in inhaltlich zwei verschiedene Teile aufzusplitten. In den ersten 90 Minuten etabliert der Film acht spannende und geheimnisvolle Charaktere. Wie kein zweiter vermag der Kultregisseur Dialoge, Schauspieler und die Figuren, die sie verkörpern in Einklang zu bringen. So fällt es schwer den famosen Cast rund um Kurt Russel, Samuel L. Jackson, Tim Roth, Bruce Dern, Zoe Bell und Channing Tatum in bessere und schlechtere Leistungen einzuteilen, doch zwei Akteure stachen mir besonders ins Auge. Zum einen Walton Goggins (Sons of Anarchy, Justified), der als schleimiger Opportunist am direktesten das Fehlen jeglicher Moral und Güte im archaischen Amerika verkörpert. Zum anderen begeisterte mich Jennifer Jason Leigh, die als Gefangene und Zentrum der Handlung zwar den Großteil des Films an den Arm von Kurt Russell gefesselt ist, doch mit ihrer bloßen Mimik eine schelmische Verschlagenheit an den Tag legt und unterschwellig offenbart, wie weit überlegen sie ihren männlichen Konterparts ist. Denn deren Missgunst, Gier und soziale Unfähigkeiten leiten in den minimal schlechteren zweiten Teil von The Hateful 8. Nach einer regelrecht spektakulär langsamen ersten Filmhälfte nehmen im weiteren Verlauf, das Tarantino-typische Chaos und die damit einhergehende Dezimierung der hasserfüllten Acht ihren Lauf. Etwas jedoch schmälert im Verlauf der zweiten 90 Minuten den Hochgenuss, der The Hateful 8 bis dato war. Die ausufernde, comichaft überzeichnete Gewaltspirale, die im direkten Vergleich besonders Reservoir Dogs, Kill Bill Vol.1 und Django unchained trotz ihrer Brutalität allgemein verträglich bleiben ließ, wird hier etwas überdreht. Die gewohnt skurrile und herrlich überdreht-witzige Story mag diese Ernsthaftigkeit des Gore-Faktors nicht gut zu Gesicht stehen. Dazu weiß jeder, der in den letzten 25 Jahren einen Film sah, dass es maximal wenige handelnde Personen lebend aus Minnies Miederwarenladen (der Ort des hauptsächlichen Filmgeschehens) schaffen werden. Somit konzentriert sich das Hauptgeschehen zu sehr darauf, den Zuschauer zu überraschen, wann wer wie sterben wird. Aufgefangen wird diese leichte Ungenauigkeit im Ton des Films durch eine völlig unerwartete Rückblende, die erneut auf Tarantinos frühere Werke deutet. Generell finden sich natürlich wieder unzählige Anspielungen und Zitate auf das eigene Werk des Regisseurs obgleich The Hateful 8 Tartantinos bislang geradlinig erzähltester Film ist (Klassiker der Westerngeschichte, vor allem Werke von John Ford und Sam Peckinpah, kommen logischerweise auch nicht zu kurz). So finden sich eine bestimmte Zigarettenmarke ebenso im fertigen Film, wie ganze Dialogzeilen aus früheren Streifen des Filmemachers. Überhaupt wirkt The Hateful 8 wie eine zum Epos aufgeblähte Version der Kneipenszene von Inglorious Basterds. Trotz der eigenen Lobhudelei vermag uns Tarantino aber auch 2016 noch zu überraschen. Absurde Regieeinfälle, wie ein Off-Erzähler, der an den möglichsten und unmöglichsten Momeneten des Films regulierend ins Geschehen eingreift, nicht erwartbare Besetzungscoups und Running Gags mit Slapstick-Charakter (die Tür des Geschäfts und Jennifer Jason Leighs Gesicht spielen dabei eine große Rolle), lassen 187 Minuten Laufzeit niemals langweilig werden. Dazu trägt dann auch die glatte 1 in der B- Note breit. Die alles dominierende Kameraarbeit beeindruckt überraschenderweise mit den unfassbar breiten Aufnahmen nicht nur in Landschaftspanoramen des verschneiten, amerikanischen Nordens, sondern vermag vor allem in den Innenansichten mit enormer Tiefenschärfe mehr einzufangen, als es der Kinogänger von einem normalen Streifen gewohnt ist. Hier ist kein Teil des Bildes verschenkt worden. Des Weiteren konnte Tarantino Altmeister Ennio Morricone dazu bringen, erstmals einen seiner Filme komplett mit Musik zu hinterlegen. Zwar werden auch einige bereits bekannte Stücke eingespielt (vornehmlich langsame Countrysongs, die in krassen Kontrast zu den bedrohlich brodelnden Morricone- Themen stehen), doch der legendäre Komponist lässt The Hateful 8 zu einem Musterbeispiel dafür werden, wie sich Soundtrack und Score gegenseitig ergänzen. Genial gespielt, völlig durchgedreht, jedoch auch etwas sperrig – The Hateful 8 ist ein in jeder Hinsicht ungewöhnliches Filmerlebnis.
8/10
Für Fans von: Stagecoach, Reservoir Dogs, The Wild Bunch, Django unchained
The Hateful 8
Seit 1966 wurde das Ultra Panavision 70-Verfahren nicht mehr für einen Kinofilm eingesetzt. Die enorm breiten Panoramen aus Ben Hur, Vom Winde verweht oder Lawrence von Arabien verdanken wir dem Seitenverhältnis von 2,76:1, wie es das Drehen auf 70mm (respektive 65mm) Film ermöglicht. Quentin Tarantino erkannte nun Ultra Panavision 70 als die beste Möglichkeit das epische Gefühl dieses Filmaufnahmeverfahrens wiederzubeleben. Damit einher geht die Aufführung von The Hateful 8 in der vom Regisseur bevorzugten Variante – der Roadshow. Diese Art der Präsentation war in der großen Hollywood-Ära der 50er und 60er Jahre weit verbreitet. Filme wurden mit Ouvertüre und Intermission gezeigt und ähnelten viel eher gesellschaftlichen Ereignissen als durchschnittlichen Kinobesuchen, Zuschauer warfen sich in Schale und bekamen Programmhefte gereicht. Diese Eigenschaften prasseln nun zusätzlich zu einem dreistündigen Opus Magnum auf den ungeübten Konsumenten aus dem Youtube-Clip-Zeitalter ein - Eine fordernde, aber lohnende Erfahrung. Folgerichtig nutzt Tarantino die verordnete Pause, um The Hateful 8, der zugleich Western und Kammerspiel ist, in inhaltlich zwei verschiedene Teile aufzusplitten. In den ersten 90 Minuten etabliert der Film acht spannende und geheimnisvolle Charaktere. Wie kein zweiter vermag der Kultregisseur Dialoge, Schauspieler und die Figuren, die sie verkörpern in Einklang zu bringen. So fällt es schwer den famosen Cast rund um Kurt Russel, Samuel L. Jackson, Tim Roth, Bruce Dern, Zoe Bell und Channing Tatum in bessere und schlechtere Leistungen einzuteilen, doch zwei Akteure stachen mir besonders ins Auge. Zum einen Walton Goggins (Sons of Anarchy, Justified), der als schleimiger Opportunist am direktesten das Fehlen jeglicher Moral und Güte im archaischen Amerika verkörpert. Zum anderen begeisterte mich Jennifer Jason Leigh, die als Gefangene und Zentrum der Handlung zwar den Großteil des Films an den Arm von Kurt Russell gefesselt ist, doch mit ihrer bloßen Mimik eine schelmische Verschlagenheit an den Tag legt und unterschwellig offenbart, wie weit überlegen sie ihren männlichen Konterparts ist. Denn deren Missgunst, Gier und soziale Unfähigkeiten leiten in den minimal schlechteren zweiten Teil von The Hateful 8. Nach einer regelrecht spektakulär langsamen ersten Filmhälfte nehmen im weiteren Verlauf, das Tarantino-typische Chaos und die damit einhergehende Dezimierung der hasserfüllten Acht ihren Lauf. Etwas jedoch schmälert im Verlauf der zweiten 90 Minuten den Hochgenuss, der The Hateful 8 bis dato war. Die ausufernde, comichaft überzeichnete Gewaltspirale, die im direkten Vergleich besonders Reservoir Dogs, Kill Bill Vol.1 und Django unchained trotz ihrer Brutalität allgemein verträglich bleiben ließ, wird hier etwas überdreht. Die gewohnt skurrile und herrlich überdreht-witzige Story mag diese Ernsthaftigkeit des Gore-Faktors nicht gut zu Gesicht stehen. Dazu weiß jeder, der in den letzten 25 Jahren einen Film sah, dass es maximal wenige handelnde Personen lebend aus Minnies Miederwarenladen (der Ort des hauptsächlichen Filmgeschehens) schaffen werden. Somit konzentriert sich das Hauptgeschehen zu sehr darauf, den Zuschauer zu überraschen, wann wer wie sterben wird. Aufgefangen wird diese leichte Ungenauigkeit im Ton des Films durch eine völlig unerwartete Rückblende, die erneut auf Tarantinos frühere Werke deutet. Generell finden sich natürlich wieder unzählige Anspielungen und Zitate auf das eigene Werk des Regisseurs obgleich The Hateful 8 Tartantinos bislang geradlinig erzähltester Film ist (Klassiker der Westerngeschichte, vor allem Werke von John Ford und Sam Peckinpah, kommen logischerweise auch nicht zu kurz). So finden sich eine bestimmte Zigarettenmarke ebenso im fertigen Film, wie ganze Dialogzeilen aus früheren Streifen des Filmemachers. Überhaupt wirkt The Hateful 8 wie eine zum Epos aufgeblähte Version der Kneipenszene von Inglorious Basterds. Trotz der eigenen Lobhudelei vermag uns Tarantino aber auch 2016 noch zu überraschen. Absurde Regieeinfälle, wie ein Off-Erzähler, der an den möglichsten und unmöglichsten Momeneten des Films regulierend ins Geschehen eingreift, nicht erwartbare Besetzungscoups und Running Gags mit Slapstick-Charakter (die Tür des Geschäfts und Jennifer Jason Leighs Gesicht spielen dabei eine große Rolle), lassen 187 Minuten Laufzeit niemals langweilig werden. Dazu trägt dann auch die glatte 1 in der B- Note breit. Die alles dominierende Kameraarbeit beeindruckt überraschenderweise mit den unfassbar breiten Aufnahmen nicht nur in Landschaftspanoramen des verschneiten, amerikanischen Nordens, sondern vermag vor allem in den Innenansichten mit enormer Tiefenschärfe mehr einzufangen, als es der Kinogänger von einem normalen Streifen gewohnt ist. Hier ist kein Teil des Bildes verschenkt worden. Des Weiteren konnte Tarantino Altmeister Ennio Morricone dazu bringen, erstmals einen seiner Filme komplett mit Musik zu hinterlegen. Zwar werden auch einige bereits bekannte Stücke eingespielt (vornehmlich langsame Countrysongs, die in krassen Kontrast zu den bedrohlich brodelnden Morricone- Themen stehen), doch der legendäre Komponist lässt The Hateful 8 zu einem Musterbeispiel dafür werden, wie sich Soundtrack und Score gegenseitig ergänzen. Genial gespielt, völlig durchgedreht, jedoch auch etwas sperrig – The Hateful 8 ist ein in jeder Hinsicht ungewöhnliches Filmerlebnis.
8/10
Für Fans von: Stagecoach, Reservoir Dogs, The Wild Bunch, Django unchained