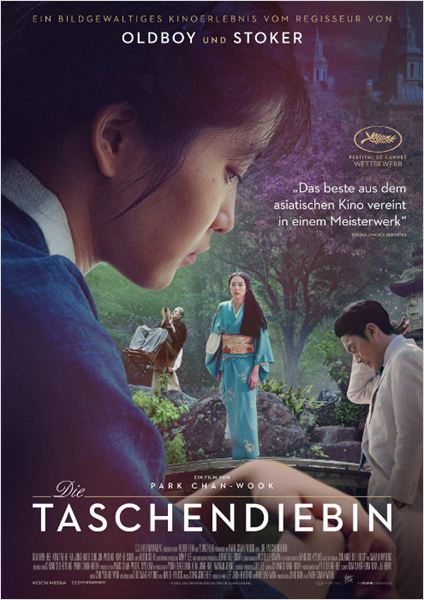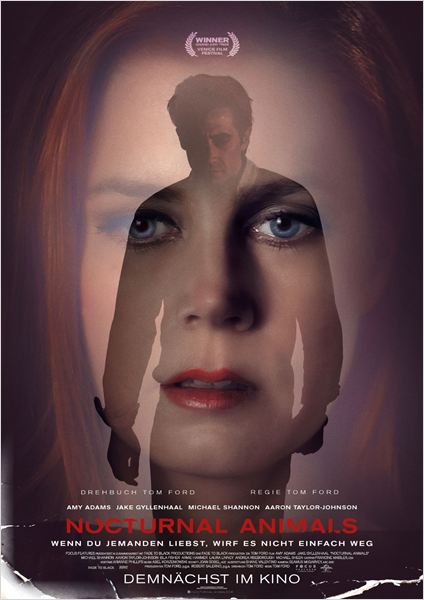Mein
Blind Date mit dem Leben
Zwei
Dinge sind mir seit der Sichtung von Mein Blind Date mit dem Leben
besonders negativ im Gedächtnis geblieben, zwei Dinge, die man
sonst eher aus amerikanischen Filmen kennt. Zum einen haben es die
Produzenten der Komödie geschafft, einen völlig belanglosen und
zugleich störenden Halbsatz als Filmtitel zu wählen. Ich kann mir
beim besten Willen nicht vorstellen, dass der Name Mein Blind Date
mit dem Leben an sich irgendwo Interesse an der, in groben Zügen
wahren, Geschichte des Saliya Kahawatte hervorrufen könnte. Womit
wir direkt beim zweiten großen Problem wären. Der Vater des
Protagonisten stammt aus Sri Lanka, Bilder des realen Saliya
Kahawatte werden in den Credits eingeblendet. Kostja Ullmann wird
dem südasiatischen Äußeren seiner Figur zu keiner Zeit gerecht.
Unabhängig von schauspielerischen Leistungen ist dieser Film ein
erschreckendes Beispiel für Whitewashing. Doch ganz von vorne.
Saliya hat einen großen Traum: Der schüchterne Teenager möchte
aus der bayrischen Provinz ausbrechen und in einem Luxushotel
arbeiten. Seine fast vollständige Blindheit steht ihm dabei
allerdings ständig im Wege. Also verheimlicht er diese und gelangt
so an einen Ausbildungsplatz. Mein Blind Date mit dem Leben verlässt
im Folgenden niemals eingefahrene Gewässer. Die Story ist einfach,
glattgebügelt und vorhersehbar erzählt. Ein Beispiel dafür:
Salyia wird von den Drehbuchautoren eine Drogensucht anerkannt, die
dramaturgisch ins Bild passt, jedoch schnell wieder aus dem
Blickfeld verschwindet und so nur als kurzfristige Stressbewältigung
inszeniert wird. Dass der wirkliche Saliya mehrere gescheiterte
Suizide überlebte, verschweigt solch ein banales Feel-Good-Movie
lieber. Weiterhin hat man in vielen Passagen der 111 Minuten
Laufzeit den Eindruck, einen Musikfilm zu sehen. Ich kann nicht
ansatzweise sagen, wie viele schmalzige Pop- und Folksongs
klischeehafte Montageszenen untermalen. 50 scheint mir allerdings
nicht zu hoch gegriffen. Saliyas Romanze mit einer Gemüselieferantin
bleibt dabei komplett uninteressant, raubt aber im letzten Drittel
jede Menge Screentime. Denn es gibt tatsächlich einige wenige
Aspekte, die Mein Blind Date mit dem Leben erträglich werden
ließen. Der Film ist dank guter Darsteller und deren Zusammenspiel
wirklich charmant gelungen und kann als ambitioniert angesehen
werden. Die Arbeit im Hotel ist verhältnismäßig realitätsgetreu
nachgestellt worden, die gezeigten Arbeitsbedingungen sind nicht
unwahrscheinlich. Die nackte, ältere Dame im Roomservice, die
schlecht polierten Gläser im Bardienst und zahlreiche andere
Hotellerie- und Gastronomieklischees muss der Kinofreund allerdings
auch hier durchstehen. Und so wird Mein Blind Date mit dem Leben mit
seinen Hochglanzbildern, dem unsachgemäßen Casting, seinen
schwülstigen Motivationsreden über Träume und Hoffnungen und
seinem unfassbar nervigen Soundtrack einfach vergessen werden.
4/10